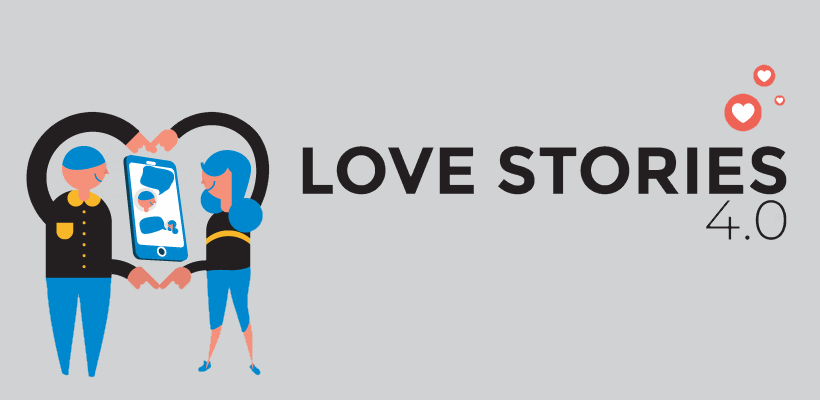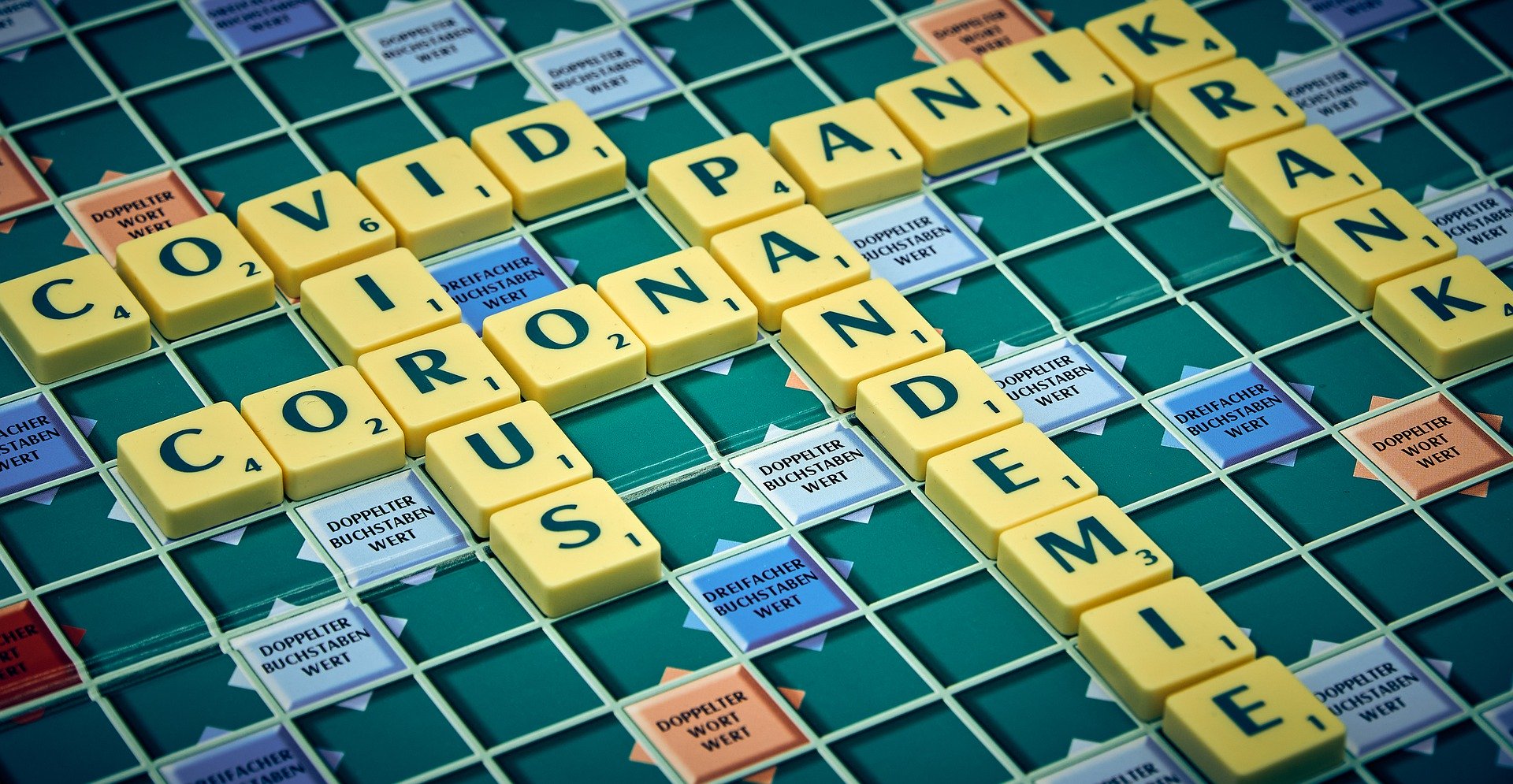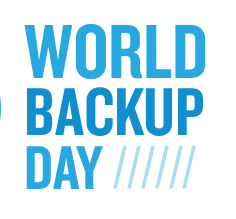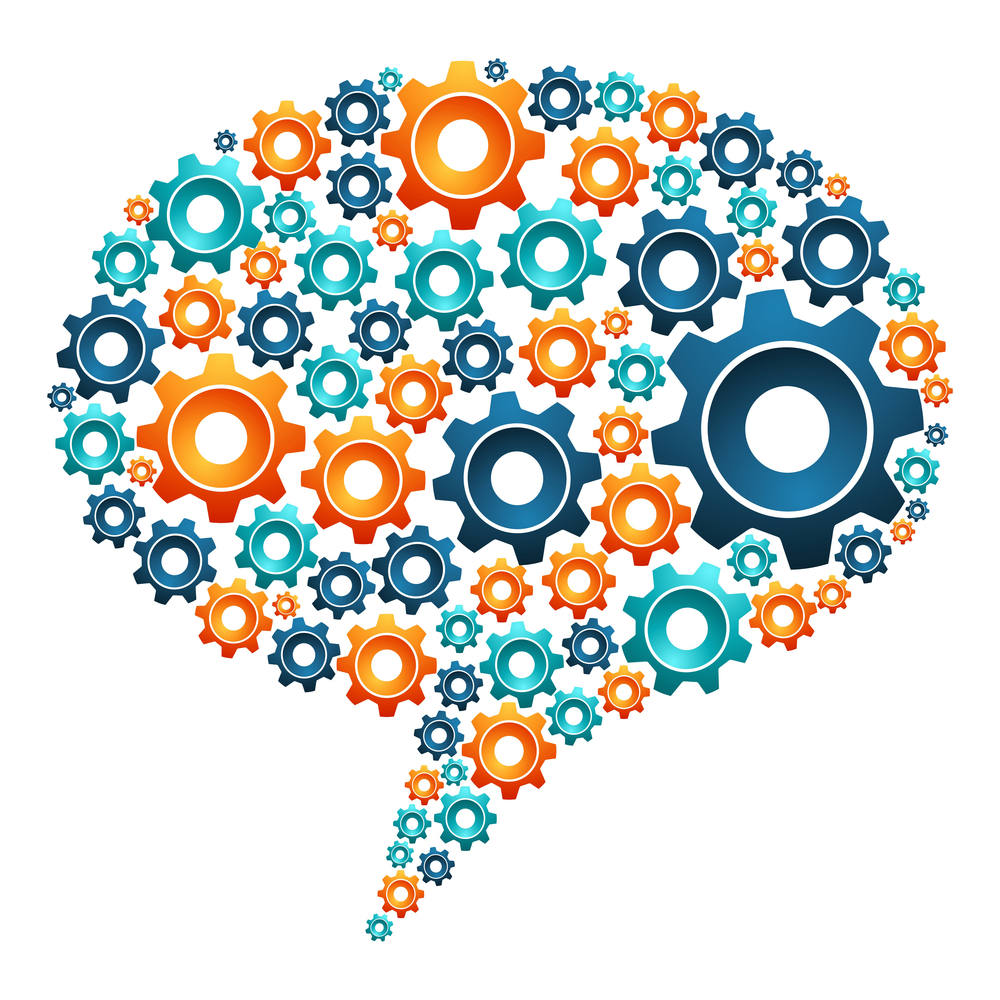Hoaxes
Der Begriff „Hoax“ tauchte erstmals Ende des 18. Jahrhunderts im englischen Sprachraum auf. Es wird vermutet, dass er sich vom Zauberspruch „Hocus Pocus“ ableitet.
Mit den neuen Medien erlebt der Begriff nun ein weltweites Revival. Ein Hoax ist eine Falschmeldung, deren Sinn darin besteht, sich schnellstmöglich weit zu verbreiten. Dank der neuen Medien geschieht dies tagtäglich über E-Mail, Messenger, SMS, MMS und vor allem über soziale Netzwerke.
Manche Hoaxes sind so ausgereift, dass ihnen ganze Webseiten gewidmet werden. Manchmal beschränken sie sich nur auf ein Gerücht, andere Male rufen sie zum Weiterleiten, zum Unterschreiben von Petitionen oder zur Teilnahme an vermeintlichen Gewinnspielen auf. Der Erfolg von Hoaxes basiert meist auf der Ausnutzung menschlicher Emotionen (Mitleid, Angst, Geldgier, Sex, Neugier). Die Schicksale, die dabei beschrieben werden, sind frei erfunden aber oft mit Fotos unterlegt, um sie glaubwürdiger erscheinen zu lassen.
Beispiele für Hoaxes gibt es unzählige. Ein Trend, der sich seit 2012 verstärkt bemerkbar macht, ist der von Links und Webinhalten, die über soziale Netzwerke unter möglichst vielen Menschen verbreitet werden sollen. Dabei schrecken sie nicht vor falschen Versprechen zurück:
„Diese 20 neuen Iphones wurden ohne Plastikfolie ums Gerät geliefert und können deshalb nicht verkauft werden. Wer das Foto an seiner Pinnwand teilt, hat die Chance, eines der neuen Geräte in Originalverpackung zu gewinnen.“
Trotz meist hanebüchenen Storys verbuchen Hoaxes einen riesigen Erfolg. Viele Menschen lassen sich von möglichen Gewinnen locken oder möchten sensationelle Nachrichten an ihre Freunde weiterschicken. Wie lange sich Hoaxes manchmal am Leben halten, zeigt der Fall „Bonsai Kitten“. Im Jahr 2000 erlaubten sich Studenten des Massachusetts Institute of Technology einen Scherz und veröffentlichten eine Webseite, auf der sie behaupteten, Bonsai-Kätzchen zu züchten. Dafür würden sie neugeborene Kätzchen mehrere Monate in kleine Glasbehälter sperren, wodurch sie die Form der Behälter annähmen. Sogar das FBI untersuchte den Fall, fand aber keine Anhaltspunkte dafür, dass tatsächlich Tiere zu Schaden gekommen sind. Obwohl die Seite schon kurz nach ihrem Erscheinen als Hoax enttarnt wurde, kursieren auch heute noch viele Mails von Tierschützern, in denen sie gegen die Seite „Bonsai Kitten“ protestieren.
Auch bei Kettenbriefen und –E-Mails handelt es sich meist um Hoaxes. Sie sollen möglichst schnell an eine bestimmte Zahl von Bekannten weitergeleitet werden,
- unter dem Vorwand, dass sonst zum Beispiel etwas ganz Schlimmes passiert (“Wenn du diese Mail nicht innerhalb von 24 Stunden an 24 Freunde weiterschickst, wird jemand, den du liebst sterben!!” – “Sende diese Nachricht an 50 Bekannte weiter oder du hast 7 Jahren Pech in der Liebe!” – “Mein Name ist Linda, ich bin vor 2 Monaten gestorben und wenn du diese Mail nicht an alle Freunde weiterschickst, werde ich dich heute Nacht als Geist heimsuchen!!”)
- oder mit dem Versprechen, dass dann ein Wunder passiert (“Wenn jeder, der diese Nachricht erhält, sie an mindestens 10 Personen weiterschickt, wird dieses kranke Baby 100.000 Euro für seine lebensrettende OP bekommen!” – “Teile dieses Bild bis Sonntag mit mindestens 20 Freunden, damit die süßen Hundebaby nicht eingeschläfert werden” – „Für jedes Teilen spendet Facebook 1 Euro an dieses hungernde Kind in Afrika“).
Generell gilt:
- Im Gegensatz zu Spam, wird ein Hoax normalerweise von Bekannten geschickt.
- Wenn ein Bekannter eine Geschichte weiterschickt, die keinen Bezug zu ihm persönlich hat, jedoch ein starkes Gefühl (z.B. Angst, Mitleid oder Hass) auslöst, handelt es sich wahrscheinlich um einen Hoax.
Erst denken, dann klicken!
Hoaxes entsprechen nicht der Wahrheit und sollten deshalb auch nicht weiter verbreitet werden. Die Schicksale, die sie beschreiben, sind frei erfunden. Man sollte sie einfach ignorieren und löschen. Im besten Fall dienen Hoaxes der Belustigung und ihrem Schöpfer genügt die Genugtuung, dass sein Gerücht sich in Windeseile in aller Welt verbreitet hat. Dennoch sind skurrile Geschichten im Netz mit Vorsicht zu genießen: Im schlimmsten Fall können sie dazu benutzt werden, Interesse auf einen Inhalt zu lenken, über den in einer zweiten Phase Schadprogramme verteilt werden.
Weiteres Risiko: Ist die Geschichte frei erfunden, beinhaltet jedoch die Namen bekannter Personen oder Unternehmen, liegt Rufmord vor.
Beispiel: „Skandalös: Die Firma XY führt Produkt-Tests an Waisenkindern aus Chile durch“.
Der Protagonist eines Hoax erleidet einen Imageschaden, der wiederum zu einem nicht zu unterschätzenden Geldschaden führen kann. Wer in solchen Fällen bei der Verbreitung von Hoaxes hilft, macht sich unbewusst des Rufmords schuldig. Immer aber trägt er dazu bei, dass Informationen, die im Internet kursieren, weniger ernst genommen werden. Die Flut an Falschmeldungen, die uns täglich in sozialen Netzwerken und per E-Mail erreicht, führt dazu, dass wir abstumpfen für Informationen, die tatsächlich unseres Interesses würdig wären.